Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen und das alles in den eigenen vier Wänden auf engem Raum ist alles andere als einfach. Hier sind ein paar Tipps, wie’s trotzdem klappen kann.
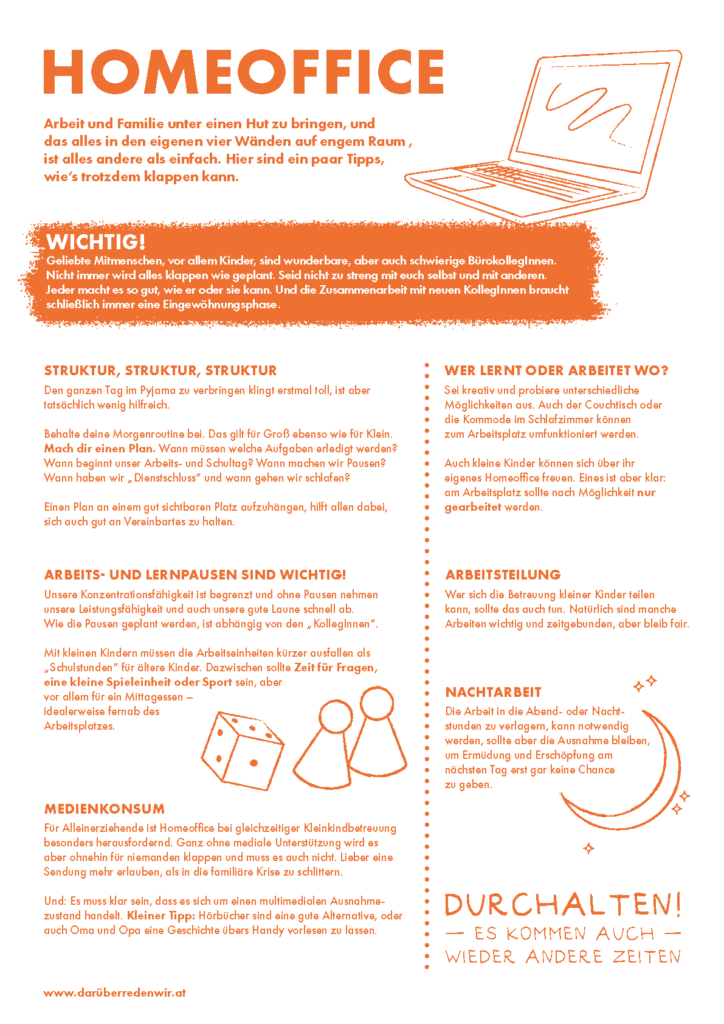

Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen und das alles in den eigenen vier Wänden auf engem Raum ist alles andere als einfach. Hier sind ein paar Tipps, wie’s trotzdem klappen kann.
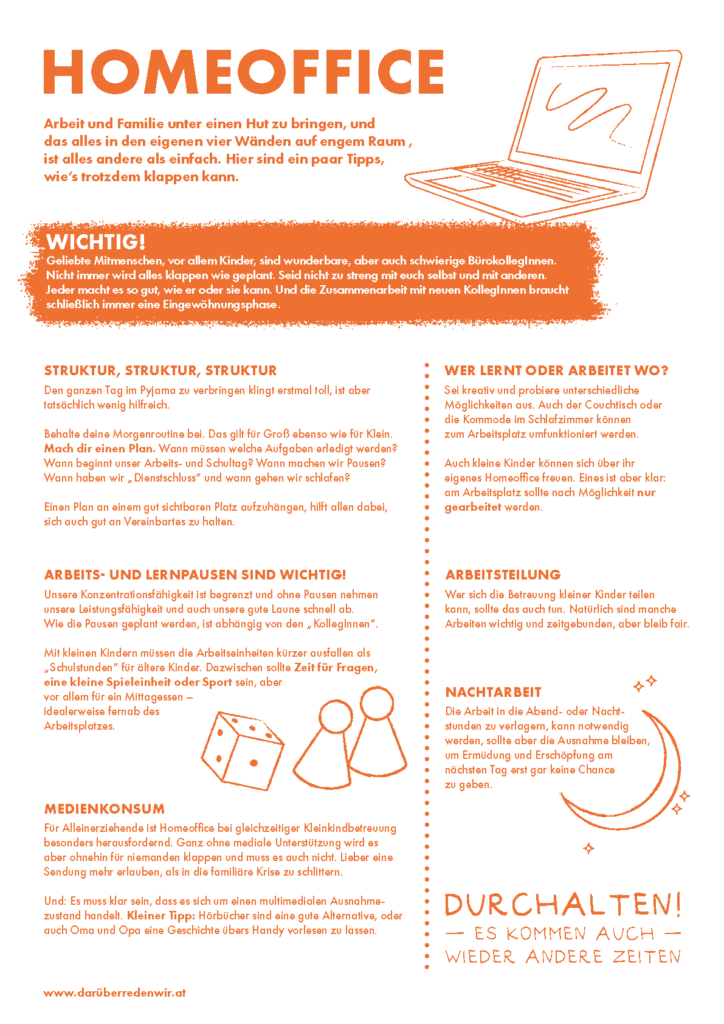

UPDATE Juni 2020
Wie können wir in Zeiten des Coronavirus weiterhin gesund bleiben?
Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
Denn auch wenn die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus momentan gelockert werden, können trotzdem viele psychische und soziale Belastungen bleiben.
Gesund bleiben, körperlich und psychisch, geht deshalb weiterhin nur
gemeinsam, mit Ruhe und Gelassenheit — und wenn wir vorsichtig und achtsam bleiben.
Zieht weiterhin alle an einem Strang, vor allem zu Hause und auch in der Öffentlichkeit.
Euch allen vielen Dank für diese wichtige Unterstützung im „Kampf“ gegen das Coronavirus.
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick – hier könnt ihr unsere Factsheets zum Coronavirus downloaden:
➔ Und wenn’s trotzdem nicht geht: Hilfe suchen! Je früher, desto besser! Denn es ist immer noch okay, auch mal nicht okay zu sein und mit den Veränderungen überfordert zu sein, es ist okay, unsicher zu sein und um Rat und Hilfe zu bitten.
Angst vor Ansteckung, die Sorge um Angehörige, Verlust des Jobs sowie Einsamkeit und viele andere Probleme können belasten.
Die Corona-Sorgenhotline bietet Unterstützung und Beratung, wenn die Sorgen groß werden. Jetzt anrufen — wir sind täglich von 8 bis 20 Uhr für dich da.
Bei allgemeinen Fragen zu Übertragung, Symptomen, Vorbeugung:
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) – Infoline Coronavirus: 0800
555 621
Bei Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus oder auftretende Symptome:
Österreichisches Gesundheitstelefon: 1450
Für Personen, die auf Hilfe angewiesen sind, aber keine Unterstützung durch Angehörige oder NachbarInnen bekommen können:
In psychischen Krisen- und Notfällen:
Die Notrufnummer der Psychosozialen Dienste in Wien: 01 31330
Alle aktuellen Informationen zu den PSD-Wien Einrichtungen findet ihr auf der Startseite der Psychosozialen Dienste in Wien: https://www.psd-wien.at/
Isolation und abrupte Veränderungen in der Tagesstruktur sind für viele eine große Belastung. Daher ist es derzeit wichtig, eine neue Routine für den Tag zu finden.
Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, rät ebenfalls dazu, sich über den Tag Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen und einzuplanen.
“Vielen Menschen hilft es, wenn sie Ordnung machen. Das beschäftigt, lenkt ab und gibt ein gutes Gefühl. Ebenso hilft vielen Menschen, wenn Sie sich den jeweiligen Tag oder die nächsten Tage gut strukturieren: ‘Sich die Zeit über den Tag verteilt einteilen, dann mache ich dieses und dann mache ich jenes’.“
Den ganzen Artikel des Kurier nachlesen: shorturl.at/bdPZ9

15 Prozent aller Frauen sind von der postpartalen Depression betroffen – doch darüber wird kaum gesprochen. Nicht nur das Unwissen und die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, auch das konservative Rollenbild erschweren das offene Gespräch. Wir haben zum internationalen Frauentag Doktorin Claudia Reiner-Lawugger, leitende Oberärztin, zu diesem Thema interviewt. Was macht diese Art der Depression aus, wohin können sich die Frauen selbst, aber auch Angehörige wenden und wie erfolgreich ist die Behandlung.
Was ist eine Postpartale Depression?
Eine postpartale Depression ist eine die psychische Erkrankungen im ersten Jahr nach einer Entbindung, die meist zwei bis drei Monate nach der Geburt des Kindes einsetzt. Dabei gibt es Krankheitsbilder wie bei einer Depression oder Angsterkrankung.
Gibt es Ursachen für diese Art der Depression?
Um die Geburt herum verändert sich sehr viel. Es ist also an sich eine große psychische Leistung, die erbracht werden muss, um diese Veränderungen gut zu verarbeiten. Die Zeit während der Schwangerschaft ist ebenfalls von sehr viel Stress und Angst geprägt. Man ist nicht einfach nur schwanger und nach neun Monaten kommt das Kind zur Welt. Es gibt viele Tests und Untersuchungen, die teilweise zu beständiger Unsicherheit führen.
Manche Mütter setzen sich selbst enorm unter Druck.. Sogenannte Leistungsmütter haben das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen, alles wissen zu müssen und alles selbst erledigen zu müssen. Das funktioniert selten. Der selbst auferlegte Druck und die 200 Baby-Ratgeber machen es für Frauen nicht einfacher.
Frauen, die z.B, in ihrer Jungend an psychischen Erkrankungen gelitten haben, sind einem größeren Risiko ausgesetzt. Aber auch zusätzliche Umstände können zu viel werden – etwa der Tod einer nahestehenden Person oder auch schon ein Umzug.
Wie sieht diese postpartale Depression aus?
Eine postpartle Depression kann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Eine Gruppe von Müttern zieht sich komplett zurück, verliert den Kontakt zur Außenwelt. Der Kontakt zum Kind funktioniert allerdings – also sowohl emotional, aber auch beim Stillen beispielsweise.
Die andere Gruppe von Müttern tut sich sehr schwer mit dem Kontakt zu dem Baby, empfindet das Kind als störend. Das ist allerdings keine bewusste Entscheidung. Es sind Emotionen, gegen die die Frauen nichts tun können. Das ist zur psychischen Erkrankung eine zusätzliche schwere Belastung für viele, dass sie die Bindung zum Kind nicht spüren.
Was sind die Symptome?
Die Symptome sind meistens Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen und Schlafstörungen. Das ist im ersten Moment für vielen nicht klar zu definieren, da man in den ersten Monaten nach der Geburt grundsätzlich nicht viel schläft. Aber wenn es dazu über Wochen hinweg kommt, dass man nicht mehr einschlafen kann, dass man nicht schlafen kann, obwohl es Kind und PartnerIn tun, dann wird irgendwann der Punkt der totalen Erschöpfung erreicht. Das erschwert natürlich die Situation zusätzlich.
Einen Satz hört man von vielen Betroffenen: „Ich hätte gerne mein altes Leben zurück“. Diese Mütter fühlen sich abgeschnitten von der Außenwelt, auch bedingt durch selbstauferlegte Verbote. Sie meinen, sie dürfen keinen Sport mehr machen, nicht mehr ausgehen, sich nicht mehr mit FreundInnen treffen. Und ziehen sich dann immer weiter zurück.
Was kann ich tun, wenn ich bei einer Bekannten oder Freundin bemerke, dass etwas nicht stimmen könnte?
Ansprechen. Das wichtigste ist, darüber zu reden. Gerade in Wien haben wir sehr viele Möglichkeiten, das dann aufzufangen.
Wenn man bemerkt, dass sich eine Bekannte immer weiter zurück zieht, dann sollte man nachfragen. In Richtung: Du meldest dich nicht mehr, was ist denn los? Geht es dir wirklich gut? Es ist schön, dass es mit dem Baby funktioniert, aber wie geht es denn dir selbst?
Sollte dann im Gespräch herauskommen, dass eine psychische Erkrankung nicht unwahrscheinlich ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Frau kann zu uns in die Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie im Wilhelminenspital kommen. Sie kann in einem Eltern-Kind-Zentrum Unterstützung erfragen oder sich an ihre Hebamme wenden.
Wie sieht die Behandlung von Betroffenen aus?
Es beginnt mit einem Gespräch. In leichten Fällen können schon kleinere Maßnahmen eine Erleichterung für die Frauen sein – zum Beispiel der Besuch einer Eltern-Kind-Gruppe, um die Isolation aufzubrechen und mit anderen Müttern in Kontakt zu treten.
Bei der Diagnostik schauen wir, welche Art der Behandlung in jenen Fällen nötig ist, die schwerwiegender sind. Wir klären also ab, ob es eine medikamentöse Behandlung oder eine Psychotherapie braucht oder eine Sozialpsychiatrische Behandlung notwendig ist. Es kann schließlich auch sein, dass mehrere Faktoren die Erkrankung bewirken oder eine Genesung erschweren. Wir wollen den Müttern die umfassende Hilfe anbieten, die sie brauchen.
Wie sind die Chancen, eine postpartale Depression wieder loszuwerden?
Sehr gut! Umso früher eine Behandlung beginnt, desto größer sind die Erfolgschancen.
Kann sie nach der zweiten Geburt wieder auftauchen?
Es ist selten, aber ich kann das Risiko nicht ausschließen. Grundsätzlich rate ich hier Frauen, die schon eine postpartale Depression erlitten haben, bei der nächsten Schwangerschaft sich einfach zu melden. So können wir einen Plan aufstellen und präventiv Maßnahmen ergreifen und damit das Risiko sehr gering halten.
Laut internationalen Studien sind bis zu 15 Prozent aller Frauen davon betroffen – warum wird so selten darüber geredet?
Die Haltung gegenüber Müttern ist noch eine sehr konservative. Die Familie muss es sich selbst richten, die Frau muss es sich selbst richten. Früher in Mehr-Generationen-Haushalten war es einfacher, dass jemand einspringt. Das ist heute nicht mehr so. Familien wohnen alleine und oft bleiben die Frauen mit den Kindern den ganzen Tag alleine zu Hause. Es ist in unserer Gesellschaft schwierig, Bewusstsein dafür schaffen, dass Mütter eben nicht einfach nur funktionieren.
Die postpartale Depression ist an sich nicht eindeutig in den Klassifizierungssystemen ICD-10 oder DSM IV/V abgebildet. Aber bei der postpartalen Depression sind die veränderten Lebensumstände ein entscheidender Faktor bzw. ein wichtiges Merkmal. Ohne Abbildung in den Klassifikationssystemen sprechen wir über eine Erkrankung, die es nicht zu geben scheint.
Seit den 90ern arbeiten wir intensiv daran, dass die postpartale Depression ebenfalls klassifiziert wird. Dass es nach wie vor keine Eindeutigkeit gibt, zeigt meiner Meinung nach auch ein gewisses mangelndes Bewusstsein für diese spezielle Erkrankung, an der besonders Mütter leiden.
Aber es wird besser. Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens äußern sich zu dem Thema. In Wien haben wir ein starkes Netzwerk. Wir sensibilisieren seit Jahren und mittlerweile wissen viele GynäkologInnen und Hebammen Bescheid und wenden sich an uns.
Doktorin Claudia Reiner-Lawugger ist leitende Oberärztin der Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie im Wilhelminenspital.

Mein Name ist Susanne und ich bin Mutter von 3 Kindern. Mein Sohn Hannes ist der Jüngste, bei ihm wurde im Jugendalter eine Borderline-Störung diagnostiziert.
Ganz allgemein zählt die Borderline-Störung zu den Persönlichkeitsstörungen. Etwa jede/r 20. Jugendliche ist davon betroffen. Die Betroffenen leiden unter Problemen bei der Regulierung der eigenen Gefühle und Impulsivität. Diese Probleme zeigen sich auch in den Beziehungen zu anderen Menschen. Häufige Symptome sind Angst vor dem Verlassenwerden, instabile Beziehungen, Identitätsstörung, instabile Gefühlslage, Gefühl von Leere sowie Wutausbrüche..
All das habe ich zuvor natürlich nicht gewusst. Wir als Eltern waren uns wirklich nicht sicher, ob es nicht einfach nur an der Pubertät liegt. Daher haben wir leider relativ spät professionelle Hilfe in Anspruch genommen.
Hannes hat unter auffällig starken Stimmungs- und Gefühlsschwankungen gelitten. Wir wussten oft nicht, wie wir mit seinen emotionalen Ausbrüchen und unüberlegtem Verhalten umgehen sollten. Verbote, Bestrafungen oder andere erzieherische Maßnahmen haben nichts bewirkt oder sogar ein gegenteiliges Verhalten hervorgerufen. Wir haben uns zeitweise wirklich machtlos gefühlt. Unser ältester Sohn hatte eigentlich immer einen sehr guten Draht zu seinem Bruder gehabt, aber auch er wusste nicht mehr, wie er mit Hannes umgehen sollte.
Hannes besucht jetzt regelmäßig einen Psychotherapeuten und erhält Training zur Besserung seiner sozialen Fähigkeiten. Vorerst haben wir uns gegen medikamentöse Behandlung entschieden. Auch wir als Eltern werden in die Therapien mit einbezogen, um die Erkrankung Borderline besser zu verstehen und zu erfahren, wie wir Hannes am besten unterstützen können.
Hannes Stimmungsschwankungen haben sich seit Beginn der Therapie merklich gebessert und er tut sich wieder leichter in der Schule mitzukommen.
Die Geschichte von Hannes und seiner Mutter ist mehreren Erzählungen von Betroffenen und Angehörigen nachempfunden. Habt ihr Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen? Wollt ihr eure Geschichte erzählen? Dann schickt uns euren Blogbeitrag, Statement, Foto,… an darueberredenwir@psd-wien.at

Ich wollte beinahe ein ganzes Jahrzehnt lang sterben. Die meisten Jahre davon bekam niemand mit – und als es dann bekannt wurde, wurde ich zum Großteil in Stich gelassen. Ich schreibe hier von meinem Weg aus diesem Teufelskreis raus und wie ich die Leute auch mit meiner Kunst dazu nochmals sensibilisieren will. Eins sei dir gewiss: Es war sehr schwer und das Fundament zur Verbesserung ist stets das liebevolle, ehrliche Umfeld.
Meine Beweggründe, sterben zu wollen
Ich hatte eine miese Kindheit. Schon im Kindergarten wurde ich gemobbt von anderen Kindern und in der Schule ging es mir leider nicht anders. Jeder Versuch, mich meinen Eltern, Erzieher oder Lehrer anzuvertrauen, ist misslungen. Mit jedem Versuch wurde mir klar, wie wenig ich ernst genommen wurde. Ich verstummte. Meine einzigen, stillen Hilfeschreie waren meine Geschichten, Gedichte und Zeichnungen. Ich versetzte mich in eine andere Welt, die zwar auch sehr gefährlich war – aber im Vergleich zur Realität war ich stark und edel. Nicht schwach und unscheinbar.
Zum Mobbing kam noch dazu, dass ich im Internat, indem ich damals in der Volk – und Hauptschule war, von mehreren Jungs missbraucht wurde. Ich wurde gezwungen, zu küssen, anfassen zu lassen und darüber hinaus so manipuliert, dass ich dachte, sie würden mich lieben. Tatsächlich aber ging es nur um Macht, wie ich durch Aufarbeitung dank Psychotherapie festgestellt habe.
Seit der Volkschule hatte ich den Wunsch, diese Erde zu verlassen. Ich fühlte mich unfassbar einsam und viel zu anders. Überall ein Außenseiter zu sein, der noch dazu intelligent und begabt ist – das war furchtbar und vor allem wusste ich nie, weshalb ich eigentlich so unbeliebt war. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an denen ich über verschiedene Selbstmordmethoden nachdachte. Einige Ideen waren schwer umsetzbar, andere waren mir zu riskant mit den Folgen, falls man überlebt. Und andere waren für mich moralisch einfach nicht vertretbar.
Letztendlich habe ich mich in meiner tiefsten Phase des Lebens mit verschiedenste Vergiftungsarten auseinander gesetzt. Mit siebzehn offenbarte ich meine Absichten und ich kam in die Station von der Kinderpsychiatrie. Dort erzählte ich dasselbe, wobei ich auch dazu sagte, dass ich mich gerne wegbeame in andere Welten. Ich bekam die Diagnose Psychose und fühlte mich absolut missverstanden. Ich dachte ja eher an Depression, aber das wurde dort mit keinem Wort so erwähnt.
Ein Jahr später: Paranoide Schizophrenie
Eine Diagnose, wo ich aus Erfahrung sagen kann, dass jeder Psychiater das ein bisschen anders definiert. Ein absoluter Laie sagt über Schizophrenie, dass diese Leute halluzinieren. Ich als erfahrene Person mit dieser zugewiesenen Diagnose sage, dass es eine Art von Kontrollverlust ist. Es ist der Verlust, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Das kann sich klarerweise durchs Halluzinieren zeigen, aber auch durch’s Auswechseln von verschiedenen Persönlichkeiten. Als ich damals paranoide Schizophrenie als Diagnose meiner psychischen Erkrankung bekam, zuckte ich einfach nur die Schulter. Ich war immer noch der Meinung, dass ich eher an etwas anderes litt, denn ich konnte mich an alle Auswechslungen der Persönlichkeiten, an alle Switches zwischen Realität und Fantasie erinnern.
In einigen Gesprächen mit einer Psychologin wurde mir immer wieder gesagt, ich solle den Bezug zur Realität aufbauen und meine Identität herausfinden . Ich lachte innerlich trocken. Ich war sehr sicher verwahrt und isoliert – wie sollte ich das machen?
Dann habe ich mir einen neuen Weg ausgedacht und angefangen, von Tierfotos realistisch nach zu zeichnen. Nach einiger Zeit kam ich dann in ein betreutes Wohnen nach Tulln – und kurze Zeit später wollte ich schon wieder sterben. Ich sprang aus dem Fenster, kurz vor Weihnachten. Im neuen Jahr darauf nahm ich etliche Medikamente zu mir, der letzte, aber auch der schlimmste Versuch. Beinahe wäre ich gestorben.
Ich wurde von Tulln entlassen und kam in ein neues betreute Wohnen. Ich wurde begrüßt und die Leute schienen freundlich zu sein. Jemand, der nur bei der Tagesstätte da war, gab sich immer wieder Mühe, Kontakt zu mir aufzubauen.
Wie konnte ich überhaupt jemandem vertrauen, nach all dem, wie ich gebrochen wurde?
Mein neues Umfeld: liebevoll, aufbauend und offen
Ich gab diesem verrückten Typen, der dauernd in meiner Nähe war, eine letzte Chance aufs Leben. Nun ja, es war die klügste Entscheidung, die ich machen konnte, denn dieser Typ ist nun mein Partner und einer der besten Menschen, die ich kenne.
Dank meinem Freund lernte ich neue Perspektiven kennen. Ich ging mit ihm abends am Wochenende aus, etwas, was mir bis heute nicht so zusagt, aber für einen echten Bezug zur Realität war mir das zum Kennenlernen sehr hilfreich. Durch ihn lernte ich, neue Freundschaften zu schließen und ich hatte eine Perspektive für meine Zukunft. Man sah sogar bei meine Zeichnungen, wie die Farben immer kräftiger wurden – sie widerspiegelten meinen seelischen Zustand. Wenn es mir schlecht ging, sprach ich mit meinem Freund darüber – und erarbeiteten uns zusammen mit BetreuerInnen eine Lösung.
Schließlich kam ich dann in eine Art Lehre im Einzelhandel und zog nach einer halbjährigen Probezeit zu meinem Partner.
Irgendwann, schwanger in der ersten Klasse Berufsschule, konnte ich meine letzten Tabletten vollends absetzen. Ich hatte zwar dank Mobbing und Heimweh durchaus eine Krise und ich zeichnete das letzte Bild für etwa ein Jahr mit dem Titel “Depression”. Es zeigt eine Frau, die auf einer dunklen Mauer sitzt, ohne Gesicht, ohne Kleidung. Sie hat kein Gesicht, weil sie diese mit ihrer schwarzen Haarpracht versteckt und zudem nach unten zu schauen scheint. Sie ist schutzlos ihrer Situation ausgeliefert, während hinter ihrem Rücken alles so bunt und harmonisch ist. So ganz ohne Schutz fühlen sich viele psychisch erkrankte Menschen, doch die Meisten können es nicht nach außen tragen, weil Unverständnis darüber herrscht. Weil Krankheiten immer noch ein Tabu sind. Somit gibt es keine Sichtbarkeit und genau das war mir bei diesem Bild so wichtig. Wir alle wollen gehört und gesehen werden – deshalb kann ein genauer, zweiter Blick sehr hilfreich sein, um zu verstehen. Dann wird aus einer
oberflächlichen Behauptung ein Hinterfragen des Gegebenen. Aus einem “Diese Person muss sich einfach nur mehr anstrengen!” wird ein “Warum bist du nicht in der Lage, deine Aufgaben zu erledigen?”
Ich blieb während meiner Krise stabil und nach der Geburt meines Kindes setzte ich mich mit der Kleinkind-Hirnreife auseinander.
Plötzlich verstand ich mithilfe verschiedener Lektüre und meiner Psychotherapeutin sämtliche Muster und seit Beginn 2019 zeichne ich immer wieder Bilder, die beinahe alle ein Ergebnis von Selbstreflektion sind. Mir wurde klar, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, die jedoch durch Psychotherapie und meiner Kunstschaffung sehr gut aufgearbeitet wurde und immer noch wird. Ich verfolge jetzt auch ein neues Ziel: Ich möchte eine Enttabuisierung von psychischen Krankheiten, aber auch gewisse gesellschaftliche Muster herbeiführen, mit meinen Bildern und mit meinen Beiträgen.
Dank meines immer noch liebevollen Umfelds bleibe ich auch stabil, weil ich weiß: ich bin nicht alleine, man nimmt mich ernst.
Und daraufhin folgt auch mein Appell an alle da draußen: Nehmt die Leute ernst. Auch, wenn diese scheinbar den größten Schwachsinn quasselt. Haltet kurz inne, nehmt die Person ernst, hört zu. Seid für diese Menschen da und sagt nicht einfach solche Sätze wie: “Der gehört eingewiesen.” “Die ist einfach nur faul.” “Übertreib nicht.” Das verletzt und man kann auch freundlich formulieren in “Ich möchte dir dabei helfen, dass es dir wieder besser geht.” “Warum kannst du nicht arbeiten gehen?” “Wieso ist das so schlimm für dich?”
So wirst du als Außenstehender Teil eines neuen, liebevollen Umfelds und die Welt wird ein kleines Stück wärmer und empathischer. Gerne kannst du mich auch auf meiner Webseite besuchen, meine Mahnmale – so nenne ich auf liebevolle Weise meine Bilder – betrachten und dich gerne auch in meinen Newsletter anmelden, um zum Achtsamkeitshelden zu werden!
Vielen Dank für die Zusendung! Es erfordert viel Mut, darüber zu sprechen und wir sind froh, diese Erzählungen mit euch allen teilen zu können. Hast auch Du Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und willst darüber reden? Möchtest du auch ein Statement oder einen Blogbeitrag beisteuern? Dann schicke uns deinen Text, dein Statement, dein Foto,… an darueberredenwir@psd-wien.at.

Psychose bedeutet ganz allgemein, dass es zu einem Verlust des Realitätsbezuges kommt. Äußere und innere Wahrnehmung der Betroffenen sind verändert.
Zum Beispiel können sie Gesichter anderer Menschen, die ihnen begegnen, als verzerrte Grimassen wahrnehmen. Oder sie haben das Gefühl, dass sich ihre Körperteile verflüssigen.
Solche Halluzinationen – also etwas zu riechen, schmecken, fühlen, hören oder sehen, was real nicht erklärbar ist – können alle möglichen Formen annehmen. Eng damit verknüpft sind irreale Gedankengebilde, auch Wahn genannt.
Das ist sehr schwer vorstellbar, aber genau solche unrealistischen Wahrnehmungen (Halluzinationen) und/oder Gedanken (Wahn) sind die Realität von Menschen, die an Psychosen leiden. Ihr Umfeld reagiert leider meist mit Unverständnis und distanziert sich.
Psychosen bzw. psychotische Symptome sind häufig mit den verschiedenen Formen der Schizophrenie verbunden und kommen auch bei anderen psychischen Erkrankungen vor.
Dementsprechend können Psychosen verschiedene Ursachen haben. Grundsätzlich wird eine Kombination aus erblicher Vorbelastung, sehr schwierigen Lebensumständen und einem Ungleichgewicht in der Produktion von Dopamin im Gehirn angenommen.
Psychosen sind gut behandelbar. Erkrankungen mit psychotischen Symptomen werden grundsätzlich medikamentös und psychotherapeutisch behandelt.
Früher galten Psychosen als nicht therapierbar – viele denken das leider fälschlicherweise auch heute noch. Daher ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was Psychosen sind, wie es Betroffenen geht und dass auch Psychosen gut behandelbar sind.

Seit meinen Zwanzigern leide ich phasenweise an Depression. Meine letzte Episode war besonders schwierig, da sie einsetzte als ich gerade meinen Traumjob ergattert hatte.
Eigentlich hätte ich überglücklich sein sollen, aber das war ich nicht. Ich habe meine Erkrankung als ein schwarzes Loch im Bauch empfunden, das all meine positiven Gedanken in Antriebslosigkeit, Gleichgültigkeit und Angst umwandelte.
Im Büro habe ich die meiste Energie nicht in die Arbeit gesteckt, sondern damit verschwendet, fröhlich und motiviert zu wirken. Denn ich habe mich für meine Depressionen geschämt. Ich wollte nicht, dass meine neuen KollegInnen von mir dachten, ich sei komisch oder weinerlich. Ich hatte Angst, dass sie mich von Anfang an ausschließen würden, wenn ich mich eben nicht verstellte.
Dabei fand ich es unglaublich schwer, mich jeden Morgen aufzuraffen und in die Arbeit zu gehen. Denn die Nächte waren schrecklich. Ich lag stundenlang wach und machte mir über alles Sorgen. Wenn ich eventuell in einen unruhigen Schlaf rutschte, wachte ich kurz darauf wieder verschwitzt und gestresst auf – und das Nacht für Nacht. Am Morgen war ich komplett ausgelaugt und voller Angst vor dem bevorstehenden Tag.
Das ging nur so lange „gut“, bis es mir einfach zu viel wurde und ich mein schwarzes Loch nicht mehr verstecken konnte. Ich habe mir dann professionelle Hilfe geholt und eine Auszeit genommen. Wären Depression und andere psychische Erkrankungen nicht dermaßen mit Vorurteilen behaftet, hätte ich wahrscheinlich früher mit jemandem geredet und hätte vielleicht auch keinen Arbeitsausfall gehabt.
Jetzt bin ich wieder zurück im Job und es geht mir gut – meine Therapie hilft mir sehr. Ich schaffe es auch meine depressive Phasen soweit im Griff zu haben, dass ich im Alltag und in meinem Berufsleben nicht einschränkt bin. Meine KollegInnen wissen von meiner Erkrankung und nehmen Rücksicht darauf. Ich bereue es, dass ich nicht früher darüber gesprochen habe – reden hilft, und wenn jemand zuhört, hilft das noch mehr.
Oft sind Menschen irritiert, wenn sie erfahren, dass ich an Depression leide und dennoch so gut in meinem Job bin und mein Leben meistere. Das ist auf eine gewisse Art und Weise schon verletzend – Ja, es ist eine Erkrankung, aber trotzdem kann man ein gutes Leben damit führen. Es braucht dazu nur den Zugang zu einer Therapie und zu notwendigen Hilfsangeboten – und natürlich den Mut Hilfe anzunehmen. Ich bin froh, dass ich diese Schritte getan habe.

Meine Oma hat Demenz. Es hat vor einigen Jahren begonnen, dass sie auffällig vergesslich geworden ist. Wir haben es zuerst einfacher Altersvergesslichkeit zugeschrieben, dass sie die Namen ihrer Nachbarn vergessen hat oder ihr Telefon in den Kühlschrank gelegt und nicht mehr wieder gefunden hat.
Doch als sie begonnen hat, meine Mutter und meinen Onkel täglich mehrmals anzurufen, um zu fragen wie spät es ist, fingen wir an, uns Sorgen zu machen. Meine Mutter hat dann einen Termin beim Arzt für sie ausgemacht.
Sie hat dem Psychiater ganze Passagen aus ihrem Lieblings-Theaterstück zitieren können und kreative Erklärungen dafür gefunden, warum sie sich an die Namen ihrer Enkel nicht mehr erinnern kann. Der Gedächtnistest hat trotzdem ergeben, dass sie an Alzheimerdemenz leidet.
Oma hat dann Medikamente verschrieben bekommen, die das Fortschreiten ihrer Demenz hemmen sollten. Ihr Erinnerungsvermögen hat sich zwar nicht merklich verbessert, aber es ist bis jetzt auch nicht schlechter geworden. So kann sie momentan noch halbwegs selbstständig in einer betreuten Wohnanlage leben.
Für meine Mutter ist es eine sehr belastende Situation. Sie merkt besonders, wie sich ihre Persönlichkeit über die Jahre immer mehr verändert hat und es schmerzt sie, dass sich Oma kaum mehr an ihren verstorbenen Mann, unseren Opa, erinnern kann.
Mama nimmt jetzt auch selbst therapeutische Hilfe in Anspruch, um mit der Situation fertig zu werden. Sie hat dort auch gelernt, wie man am besten mit Demenz-Erkrankten umgeht. Wir versuchen Oma so gut es geht zu unterstützen und sie nicht dauernd auf ihre Defizite aufmerksam zu machen. Diese Erzählung ist verschiedenen Berichten von Angehörigen nachempfunden. Demenzielle Erkrankungen werden zu Beginn oft mit Altersvergesslichkeit verwechselt. Da diese Erkrankungen leider nicht komplett geheilt werden können, aber ihr Verlauf beeinflusst werden kann, ist es wichtig, so früh wie möglich Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Demenzen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Demenz ist ein Oberbegriff für eine Kombination von verschiedenen Symptomen, die seit mindestens sechs Monaten vorliegen und so stark sind, dass sie den Alltag beeinträchtigen.
Die Ursachen von Demenzen sind anhaltende und fortschreitende Erkrankungen des Gehirns. Dabei ist die Alzheimer-Krankheit die häufigste Ursache bzw. Form von Demenz.
Alle Demenzformen sind verbunden mit verschiedenen Symptomen aus den folgenden drei Bereichen:
1) kognitive Beeinträchtigungen (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Sprache,…);
2) Verhaltensänderungen (u.a. Bewegungsdrang, Unruhe, Aggressivität, Schreien) und psychische Symptome (u.a. Depression, Apathie, Angst, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Schlafstörungen);
3) zunehmende Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags.
Eine Demenz beginnt meist mit einer subjektiven Beeinträchtigung, die man zwar selbst wahrnimmt, aber die objektiv (noch) nicht festgestellt werden kann. Im Verlauf werden die Schwierigkeiten in den verschiedensten Bereichen des Alltags immer größer, bis ein Zurechtkommen alleine nicht mehr möglich ist (u.a. massive Desorientierung, Inkontinenz, Verlust der Sprache und neurologische Symptomen).
Demenz-Erkrankungen sind häufig: Weltweit sind etwa 50 bis 60 Millionen Menschen von Demenz betroffen (2040: ca. 100 Millionen Betroffene), in Österreich sind es um die 125 000 (2050: ca. 260 000). Von den unter 75-Jährigen sind nur etwa 3% betroffen, von den über 85-Jährigen sind dies etwa 30%.
Demenz geht uns alle an. Immer mehr von uns werden immer älter und grundsätzlich kann jede/r von uns an Demenz erkranken. Demenz betrifft nicht nur die erkrankten Menschen selbst, sondern auch ihre Angehörigen.
Die Beratung und Unterstützung der Angehörigen ist die wichtigste therapeutische Maßnahme. Der Gesamtbehandlungsplan ist individuell und auf die Form, das Stadium und die Symptome der jeweiligen Demenz-Erkrankung abgestimmt. Er umfasst psychosoziale Interventionen (z.B. Ergo-/Musiktherapie, kognitive Trainings, Validation) und auch medikamentöse Interventionen.
Wichtig ist eine möglichst frühzeitige Diagnose und Behandlung. Bei entsprechend umsichtiger Behandlung bzw. Betreuung können die Betroffenen und ihre Angehörigen über viele Jahre ein würdevolles Leben führen.

Darüber zu reden, was damals passiert ist, fällt mir unglaublich
schwer, aber ich will das hier auch gar nicht so genau erzählen. Das ist nicht
das, was ich erzählen will. Ich will erzählen, dass man selbst mit so einem
Erlebnis und der daraus entstandenen posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)
weiterleben kann, dass man es schaffen kann diese Erlebnisse zu verarbeiten.
Warum spreche ich so selten darüber? Weil die meisten schockiert reagieren,
mitleidig schauen und mich behandeln, als würde ich daran zerbrechen. Ich glaube,
das kommt daher, dass viele sofort Bilder im Kopf haben und selbst nicht
wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Ja ich war das Opfer von
sexuellem Missbrauch, und ja das hat Spuren hinterlassen – aber diese Spuren
machen mich doch als Person nicht aus. Ich bin doch mehr. Wenn man mich kennt,
würde man nicht glauben, dass mir so etwas passiert ist und dass ich an PTBS
leide. Ich bin eine sehr aufgeweckte und lebensfrohe Frau. Ich bin selbständig
und leite einen kleinen Betrieb.
Man geht immer davon aus, dass einem selbst so etwas nie passieren wird Man hört davon, aber man denkt: „Das passiert mir doch nicht.“ Es war daher schwer, sich einzugestehen, dass es mir passiert ist und dass mich aber keine Schuld daran trifft. Dieser Übergriff hat mein Leben auf den Kopf gestellt und hat mich lange Zeit nicht losgelassen. Ich musste mich zwingen nicht immer daran zu denken und nicht wieder alles im Kopf durchzugehen. Flashbacks und plötzlich aufkommende Angst, nur weil mich irgendetwas an die Situation erinnerte, waren meine Begleiter. Nächtelang konnte ich nicht schlafen und wenn ich einmal einnickte, fuhr ich bald wieder schweißgebadet aus einem Albtraum hoch.
Mir war klar, dass ich Hilfe brauchte, aber es war schwer, sich wirklich aufzuraffen und eine Behandlung zu starten. Wären meine Mutter und mein Vater nicht gewesen, hätte ich es nicht geschafft. Sie waren für mich da, hörten mir geduldig zu, gaben mir Zeit und unterstützen mich bei der Behandlung. Die ersten Therapietermine machten sie für mich aus, sie brachten mich auch hin. Sie haben mir ihre Hilfe nie aufgedrängt, sondern mich immer gefragt – und wenn ich etwas nicht so schnell hinbekommen habe oder Rückschritte gemacht habe, haben sie Verständnis gezeigt. Und all das, obwohl es für sie beide auch sehr schwer war. Mein Vater hat selbst Hilfe in Anspruch genommen, weil er nicht wusste, wie er am besten mit dieser Situation umgehen soll und weil er sich hilflos gefühlt hat.
Es ist 4 Jahre, 2 Monate und 5 Tage her. Ja, ich weiß das ganz genau. Obwohl Jahre vergangen sind, passiert es noch heute, dass mich ein Geruch, ein Geräusch – irgendein Trigger – an dieses furchtbare Erlebnis erinnert. Oft kann ich nicht festmachen was es genau war, manchmal schon. Diese Flashbacks kommen seltener als früher und es braucht viel Kraft mit ihnen zu leben. Aber es ist möglich – wenn man sich Unterstützung holt.
Ich liebe mein Leben – es hat lange gebraucht bis ich das wieder sagen und fühlen konnte. Der Weg bis zu diesem Punkt war lang und ich habe mich manchmal auch verlaufen oder musste ein paar Schritte zurück gehen. Mir ist auch bewusst, dass dieser Weg nicht geschafft ist, aber ich weiß jetzt, dass es machbar ist.
Ich weiß auch, dass ich Glück hatte. Glück, dass ich noch lebe; dass meine Eltern mich so unterstützen und ich ein Umfeld habe, das mir Kraft gibt. Es gibt Menschen, die sind allein in dieser Situation oder werden auch alleingelassen. Daher ist es so wichtig, dass hier mehr Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird und auch der Zugang zu Behandlungen erleichtert wird. Wir müssen mehr aufeinander achten und erkennen, dass es Situationen gibt, die Menschen aus der Bahn werfen. Es kann wirklich jeden von uns treffen. Jeder von uns kann in eine Situation kommen in der er auf einmal nicht mehr so funktionieren kann, wie es das System von uns verlangt. Das muss gesehen und auch wahrgenommen werden. Es braucht mehr Verständnis und das Bewusstsein, dass psychische Erkrankungen genauso zu respektieren sind wie körperliche Erkrankungen.
Diese Geschichte wurde Erzählungen von mehreren Betroffenen nachempfunden. Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung durchleben die traumatisierende Situation oder einzelne Elemente davon immer wieder. Schlafstörungen und Isolation sind dabei keine Seltenheit. Mit der richtigen Behandlung kann Betroffenen jedoch geholfen werden.