Finanzielle Armut und psychische Gesundheit stehen in einem engen Zusammenhang. Um Verbesserungen zu erzielen, gilt es an vielen Schrauben zu drehen. Das war das Resümee eines Facebook live Talks von Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der AK Wien und Pia Zhang, Referentin für Gesundheitspolitik der AK Wien.
Einige psychische Erkrankungen beginnen bereits im juvenilen Alter. Wenn diese nicht behandelt werden, haben sie einen massiven Einfluss auf die Lebensbiographie. Psychische Erkrankungen führen aber oftmals auch im späteren Leben zu einem Verlust des Arbeitsplatzes und finanziellen Einbußen. Gleichzeitig wissen wir, dass das untere Einkommensdrittel deutlich schwerer unter psychischen Belastungen leidet und häufiger erkranken.
Henne-EI-Problem
„Der Zusammenhang zwischen finanzieller Armut und psychischer Gesundheit ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Fest steht, dass es einen starken Zusammenhang in beide Richtungen gibt“, sagte Lochner. Außerdem sind nicht alle Menschen gleich betroffen. „Die krisenhaften Situationen der letzten Jahre haben gezeigt, dass jene Menschen, die schon vor dem Ausbruch der Pandemie belastet waren, auch von den Konsequenzen übermäßig belastet sind“, so Lochner.
Unsicherheiten im Berufsleben führen zu Stresssituationen. Aktuell werden diese durch die Teuerung weiter verschärft und verstärken sich mit der prekären Situation am Arbeitsmarkt. „Eine soziale Absicherung, gerade auch für arbeitslose Menschen, die derzeit 55% des letzten Einkommens erhalten, ist notwendig. Eine Anhebung des Arbeitslosengeldes auf zumindest 70 Prozent würde den Arbeitnehmer*innen auch helfen, um wieder Kraft zu tanken“, forderte Pirklbauer.
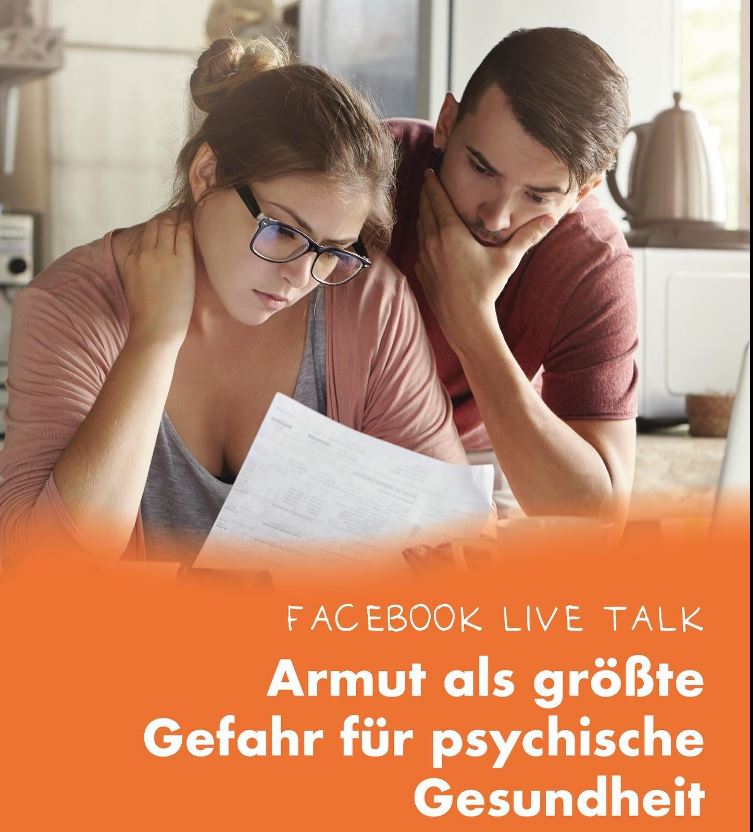
Arbeitsplatzgestaltung entscheidend
Neben der besseren finanziellen Absicherung, spielt die Arbeitsplatzgestaltung eine entscheidende Rolle. „Arbeitgeber*innen sind dabei im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht in der Pflicht, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass weniger psychische Belastungen stattfinden“, erläuterte Pirklbauer weiter. Ursachen für psychische Belastungen seien oftmals auf Diskriminierungen und Belästigungen jeglicher Art zurückzuführen. Aber auch Überlastungen durch lange Arbeitszeiten oder schwer planbare Arbeitszeiten bereiten Herausforderungen.
Der aktuelle Fehlzeitenreport zeigt klar: psychische Erkrankungen sind in den letzten Jahrzehnten im Steigen begriffen. Vor allem braucht man bei psychischen Erkrankungen oft länger, bis man sich wieder zutraut in den Beruf einzusteigen. „Und wenn die Mitarbeiter*innen wieder eingestiegen sind, müssen sie oftmals kurze Zeit später nochmals in den Krankenstand, weil sich im Betrieb nichts geändert hat und die belastende Situation weiter bestehen bleibt“, wies Zhang auf eine Herausforderung und die dahinterliegenden Zahlen hin.
Fit2work stärker nützen
Bereits gesetzte Maßnahmen, wie etwa die Wiedereingliederungsteilzeit und fit2work bewerten die Expert*innen positiv. „Allerdings wird es immer noch viel zu wenig genutzt. „Nur 17 Prozent der Menschen in Langzeitkrankenständen nehmen dies in Anspruch. Überhaupt nur ein Prozent der Unternehmen lässt sich beraten“, so Zhang. Dabei sei ein stärkerer Fokus auf psychische Erkrankungen bei den Gesundheitsmaßnahmen auch für Betriebe und den Staat von Vorteil, da dadurch massiv Kosten eingespart werden.
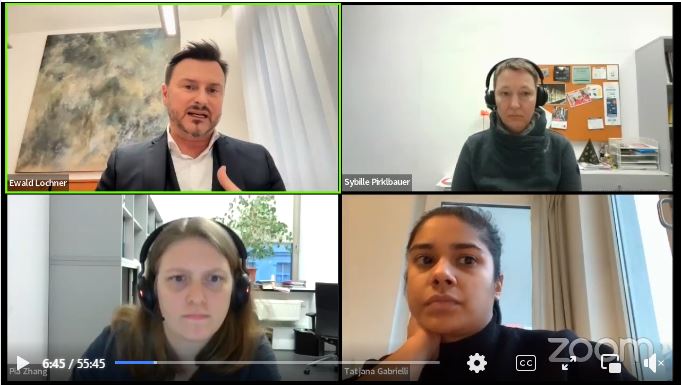
Ausbilden, ausbilden, ausbilden
„In der heutigen Arbeitswelt sehen wir einerseits Angst vor verschlechternden Arbeitsbedingungen, etwa durch mehr Arbeit bei gleichbleibendem Gehalt. Andererseits brechen, gerade bei vielen jüngeren Arbeitnehmer*innen, Lebenskonzepte zusammen, die gelautet haben: gute Ausbildung führt automatisch zu gutem Auskommen. Sie sehen, dass das nicht funktionieren wird. Dem müssen wir Rechnung tragen“, betonte Lochner, der vor allem drei Dinge forderte: erstens ausbilden, ausbilden, ausbilden. Das gelte für Ärzt*innen, Pflegepersonal und Sozialpädagog*innen. Hürden müssen abgebaut werden, etwa beim Medizinstudium. Zweitens müssen Behandlungssysteme näher an die Lebensrealität der Patient*innen angepasst werden, das heißt niederschwellig, leicht erreichbar und mit dem Beruf vereinbar. Selbiges gälte, als dritter Punkt, für das Finanzierungssystem. Auch das muss sich stärker am Bedarf der Patient*innen orientieren.
Bewusstsein für psychische Erkrankungen erhöhen
Das Bewusstsein für psychische Erkrankungen sei auch in den Betrieben deutlich ausbaufähig, konstatierte Pirklbauer. Außerdem brauche es Arbeitsbedingungen, die nicht psychisch krank machen. Im Falle einer Erkrankung ist es notwendig, diese rasch zu erkennen und Expertise zu holen. Und sollten Erkrankungen zu Arbeitsausfällen führen, müssen Chancen gegeben sein, wieder zurückzukehren.
Für Zhang ist der kostenlose, niederschwellige Zugang zu Gesundheitsleistungen eine Grundforderung. Und dies in einem ausreichenden Ausmaß. Auch wenn das Angebot durch die ÖGK kürzlich erhöht wurde, sei der Bedarf noch lange nicht gedeckt. „Eine lange Wartezeit auf eine Behandlung hat eine massive Auswirkung auf die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Menschen“, warnte sie und sprach auch eine weitere Risikogruppe in diesem Zusammenhang an: pflegende Angehörige, deren Aufgabe zu einer extrem starken psychischen Belastung führe.

