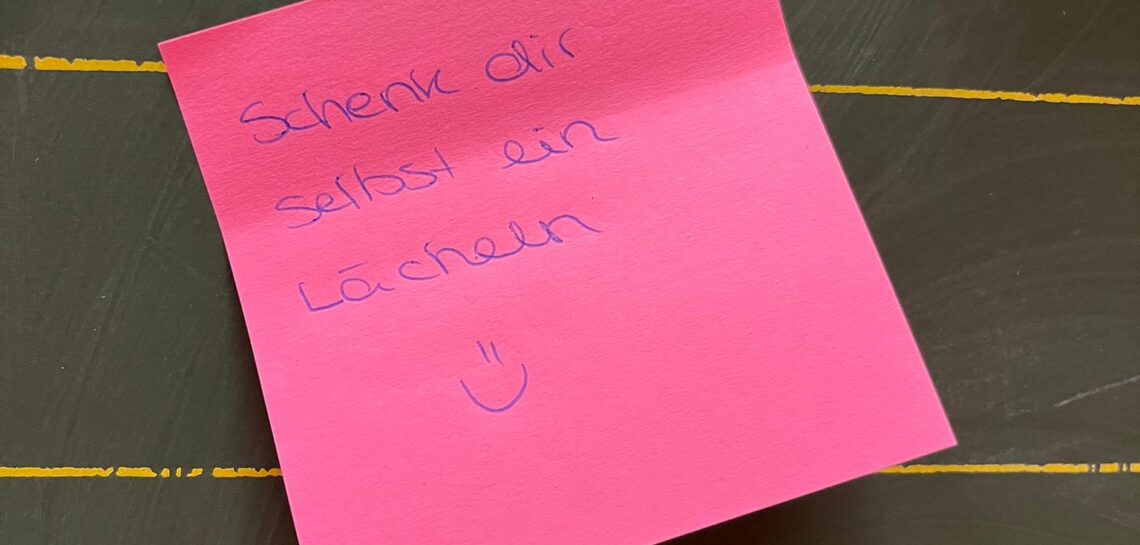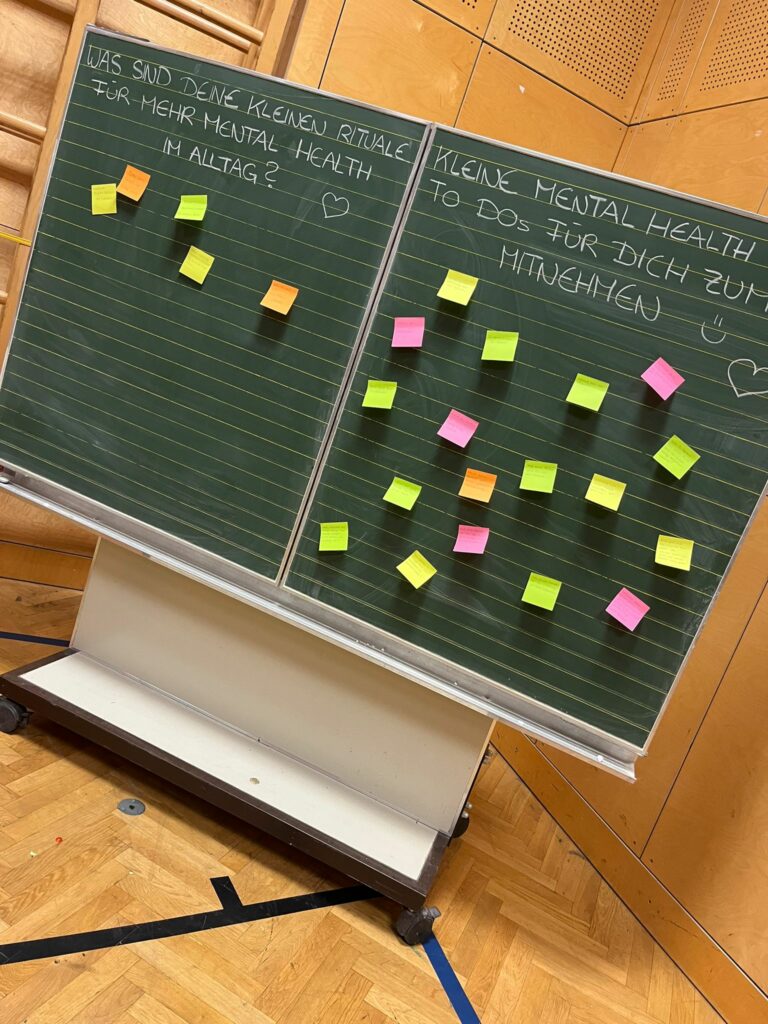Im Interview mit #darüberredenwir spricht die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Ärztliche Leitung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulatoriums Leopoldstadt der Psychosozialen Dienste in Wien, Dr.in Doris Koubek, über aktuelle Herausforderungen, Belastungen und Behandlungswege für junge Patient*innen.
Interview mit Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr.in Doris Koubek
DRW: Aktuelle Krisen haben insbesondere jungen Menschen zugesetzt. Die Pandemie, Krieg, Naturkatastrophen, die Klimakrise und die Teuerung bekommen, belasten Kinder und Jugendliche psychisch zwar unterschiedlich stark – aber die Belastungen sind da. Wie wirken sich diese aus?
Dr.in Doris Koubek: Wir haben bereits in der Pandemie einen erschreckenden Anstieg an psychiatrischen Erkrankungen gesehen: Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Suizidgedanken haben sich gehäuft. Zudem ist “die Jugend” ein ganz besonderer Zustand im neurobiologischen Sinne. Wir probieren neue Dinge aus, wir gehen Risiken ein, wir lernen uns selbst kennen. Gleichzeitig ist eine hohe Bereitschaft zu emotionalen Reaktionen der Grund, dass Krisen mehr auf uns Einfluss haben. Doch wie auch bei Erwachsenen, sind es besonders marginalisierte Kinder und Jugendliche, die die psychischen Folgen der Krisen zu spüren bekommen. Beispielsweise werden Ängste und Verzweiflung über aktuelle problematische Situationen ungefiltert auf den Alltag übertragen.

Von welchen Kindern und Jugendlichen sprechen wir hier?
Es geht dabei um junge Menschen, die von Armut betroffen sind. Die natürlich die Verzweiflung der Eltern mitbekommen, die selbst an ihrer Zukunft zweifeln, die nicht die Möglichkeiten auf Unterstützung haben, weil Wissen und Geld fehlt. Es geht auch um Kinder und Jugendliche, die keine stabilen Familienverhältnisse haben, die fremduntergebracht worden sind, die früh schwer traumatisiert wurden, die Gewalt erlebt haben. Das betrifft auch geflüchtete Menschen, besonders vulnerabel sind hier unbegleitete Minderjährige. Kinder und Jugendliche haben es derzeit nicht leicht, aber es wäre falsch, so zu tun, als gäbe es nicht signifikante Unterschiede, die sich auch auf die psychische Gesundheit bzw. die Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen auswirken.
Welche Anzeichen gibt es für eine psychische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen?
So pauschal kann das nicht festgelegt werden. Diagnosen sind vielfältig und komplex. Wir Behandler*innen beobachten derzeit eine besonders paradoxe Situation: Einerseits existiert nach wie vor ein extrem großes Stigma rund um das Thema Psychiatrie und psychische Erkrankungen, andererseits wird das Verhalten von Kindern und Jugendlichen überpathologisiert. Man muss sich fragen, was gehört zur Adoleszenz, was gehört zum Erwachsen werden dazu? Dass junge Menschen Wut, Angst und Liebe anders empfinden, liegt auf der Hand – der Umgang mit Emotionen und eine Kontrolle der Impulse wird in dieser Zeit gelernt. Oder sollte gelernt werden. Auch hier spielen Ressourcen und Umgebung eine große Rolle für Kinder und Jugendliche.
Wir beobachten beispielsweise, dass Mobbing grausamer geworden ist. Oftmals werden junge Menschen nicht ernst genommen, aber ihnen wird massive Gewalt von Gleichaltrigen angetan – das darf nicht unterschätzt werden.
“Von meinen Patient*innen geben etwa 60-65 Prozent an, mindestens einmal gemobbt worden zu sein, auf erschreckende Art und Weise. Wichtig wäre es, dass sie sich früh jemandem anvertrauen können und dass ihnen geglaubt wird.”
Was können Eltern, Betreuer*innen und Ärzt*innen tun, wenn der Verdacht einer psychischen Krise oder Erkrankung vorliegt?
Psychische Krisen gilt es ernst zu nehmen. Genau zuzuhören und auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen, ist sehr wichtig. Kinder und Jugendliche sollten sich aber bewusst sein, dass regelmäßiger Schlaf, Motivation, Freude wichtige Indikatoren für ein gesundes Leben sind. Wenn Freud- und Motivationslosigkeit, lang anhaltender Schlafmangel oder Schlafstörungen den Alltag bestimmen, wenn ein extremen Rückzug und Isolation stattfinden, plötzlich Veränderungen im Verhalten, dann sollte das Gespräch gesucht werden. Aber eben auch die richtige Unterstützung aufzusuchen. Grundsätzlich gilt es, wie bei allen Erkrankungen, eine fachärztliche Einschätzung oder Diagnose einzuholen. So kann dann der weitere Behandlungsweg gemeinsam erstellt werden. Aber auch hier sind wir uns sehr bewusst, dass es für Erwachsene ohne (manchmal auch mit) der richtigen Ausbildung und den notwendigen Ressourcen nicht einfach ist. Trotzdem ist es besser, sich über beispielsweise telefonische Angebote beraten zu lassen, anstatt wegzuschauen.
“Ich erlebe eine gewisse Vereinsamung der Kinder und Jugendlichen, denen es nicht gut geht, die aber in erster Linie auf Verständnis hoffen. In unserer Leistungsgesellschaft ist es sehr schwierig, dass es einem einfach mal schlecht geht. Ob eine Phase der Traurigkeit wegen Liebeskummer oder Streit mit dem besten Freund – alles kann eine Belastung darstellen, die man auch gemeinsam aushalten muss, anstatt alles dafür zu tun, dass sie sofort verschwinden.”
Jugendliche haben durch Social Media und den Generationenwechsel eine wesentlich offenere Gesprächsbasis. Psychotherapie und das Wissen rund um verschiedene Krankheitsbilder sind wesentlich höher. Wieso ist es dennoch, notwendig, junge Menschen aufzuklären?
Insbesondere Online lauern die Fallen der Fake-News oder simplifizierten Diagnosen, die fachlich nicht ausreichend sind. Zudem erleben wir auch, dass es nach wie vor enorme Defizite, und dass es Vorurteile beim Thema Psychiatrie und Behandlungsformen, wie etwa eine medikamentöse Therapie, gibt. Viele Menschen haben schon von der Psychotherapie gehört, kennen den stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Abteilung nur aus Horror-Filmen und von ambulanter Behandlung haben sie noch nie etwas gehört.
Was bedeutet „ambulante Versorgung“ und was geschieht dort?
Hier soll gewährleistet werden, dass so gut es geht, der Alltag der Kinder und Jugendlichen in die Behandlung miteinfließt. Die Hauptaufgabe der Ambulatorien liegt in der medizinischen Behandlung und in der Unterstützung bei der persönlichen,sozialen und schulischen bzw. beruflichen Entwicklung. Die zugehörigen Tageskliniken können von Kindern und Jugendlichen als Alternative zu einer stationären Behandlung. Die jungen Patient*innen werden von einem multiprofessionellen Team behandelt, betreut und begleitet: Fachärzt*nnen für Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Klinische Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Ergotherapeut*innen und Physiotherapeut*innen. Die Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Angehörigen sind für die jungen Patient*innen und deren Bezugspersonen sehr wichtig.

Haben Kinder und Jugendliche mit Essstörungen einen so speziellen Behandlungsbedarf?
Grundsätzlich hat natürlich jeder Mensch einen individuellen Behandlungsbedarf. Daher ist auch unser multiprofessioneller Ansatz so wichtig. Wie viele psychische Erkrankungen ist auch die Essstörung im Sinne eines biopsychosozialen Modells zu betrachten. Veranlagungen und Umstände sind entscheidende Faktoren für die Entstehung.
Eine Essstörung ist jedoch eine der schwersten Erkrankungen, die wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) haben, da sie massive körperliche Schäden nach sich zieht bzw. ziehen kann. Wir brauchen hierbei unbedingt die fachärztliche Behandlung und erfahrene Professionist*innen, da die Erkrankung äußerst komplex ist und leicht chronifiziert – im schlimmsten Fall verhungern die Patient*innen. Psychotherapie reicht hier alleine nicht! Zudem braucht es besondere Sensibilität und Wissen, denn im Hintergrund läuft bei den Patient*innen ein Programm ab, das kaum etwas mit dem Gespräch mit dem Gegenüber zu tun hat.
Wo sehen Sie die aktuellen Herausforderungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie?
Wir haben einen extremen Mangel an Fachärzt*innen. Das hört nicht bei Kinder- und Jugendpsychiater*innen und psychiatrischem Pflegepersonal auf, das betrifft alle Bereiche, die Kinder und Jugendliche mit psychische Problemen umfassen. Etwa Sozialpädagog*innen, soziale Berufe, die Heime und Wohgemeinschaften betreuen, all das sind extrem anspruchsvolle Jobs, die durch den Mangel an Personal und Ressourcen nicht einfacher werden.
“Wenn ein bis zwei Betreuer*innen 8-10 teilweise traumatisierte Jugendliche mit psychischen Problemen betreuen, fällt natürlich die so wichtige Beziehungsarbeit extrem schwer.”
Das macht es noch schwieriger, die sehr vielen Kinder und Jugendlichen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichen Bedürfnissen durch unterschiedliche Maßnahmen zu unterstützen und behandeln. Denn eigentlich müssten wir alle, die mit den Patient*innen zu tun haben, an einem Tisch sitzen und uns genau anschauen, was für den jungen Menschen passen würde: Medikament, Therapieform, Setting, ob vollstationär, ambulant,…
Der psychosoziale Dienst möchte auf all diese Themen und Forderungen mit der Kampagne #darüberredenwir aufmerksam machen. Was braucht es denn, damit die Menschen eine möglichst gesunde Psyche haben?
Die Entstigmatisierung aller psychischen Erkrankungen und der Behandlung ist eine wichtige Säule. Nur wenn wir tabulos darüber reden können, kann Betroffenen adäquat geholfen werden. Aber es ist auch eine Frage der Verteilung, der Gerechtigkeit, der Vielfalt: Auch im Gesundheitssystem, so gut es in Österreich ist, gibt es Ausschlussmechanismen. Das trifft etwa Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die sich am Land befinden, das betrifft Menschen mit weniger Bildungschancen, Sprachbarrieren usw. Psychische Gesundheit sollte kein Privileg sein, sondern für jeden Menschen eine Selbstverständlichkeit – egal woher er kommt. Kontaktaufnahme bzw. Möglichkeit klären.
Wenn Du Fragen hast, wende dich gerne an die Psychosoziale Information der Psychosozialen Dienste in Wien:
- 01 4000 53060 – von 08:00 bis 17:00 Uhr täglich
Wenn Du Dich belastet fühlst, nimm die Wiener Sorgenhotline in Anspruch – damit Sorgen nicht zur Krise werden:
- 01 4000 53000 – von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich
In akuten psychiatrischen Notfällen wende Dich an den Psychosozialen Notdienst des PSD-Wien:
- 01 31330 – rund um die Uhr
Der Artikel mit Dr.in Doris Koubek erschien im Juni 2023 in gekürzter Form in ÄRZTE EXKLUSIV.