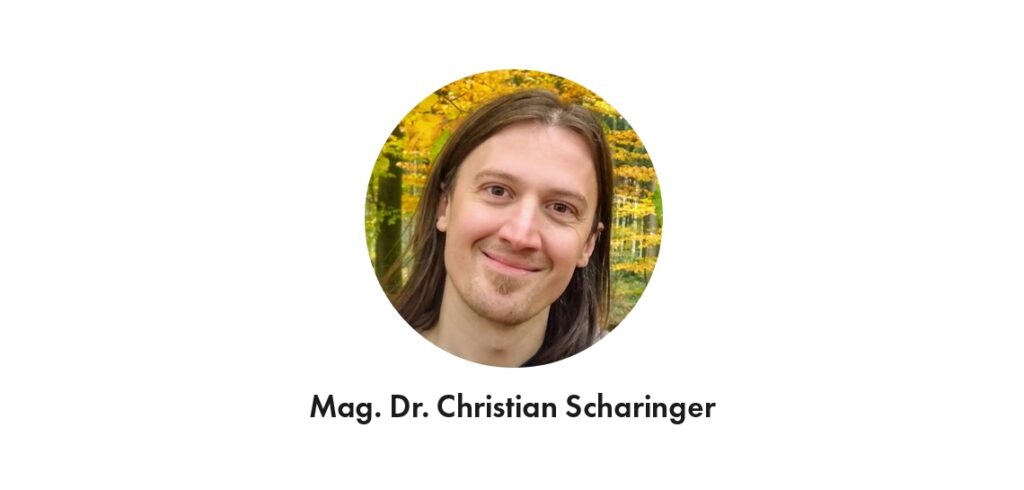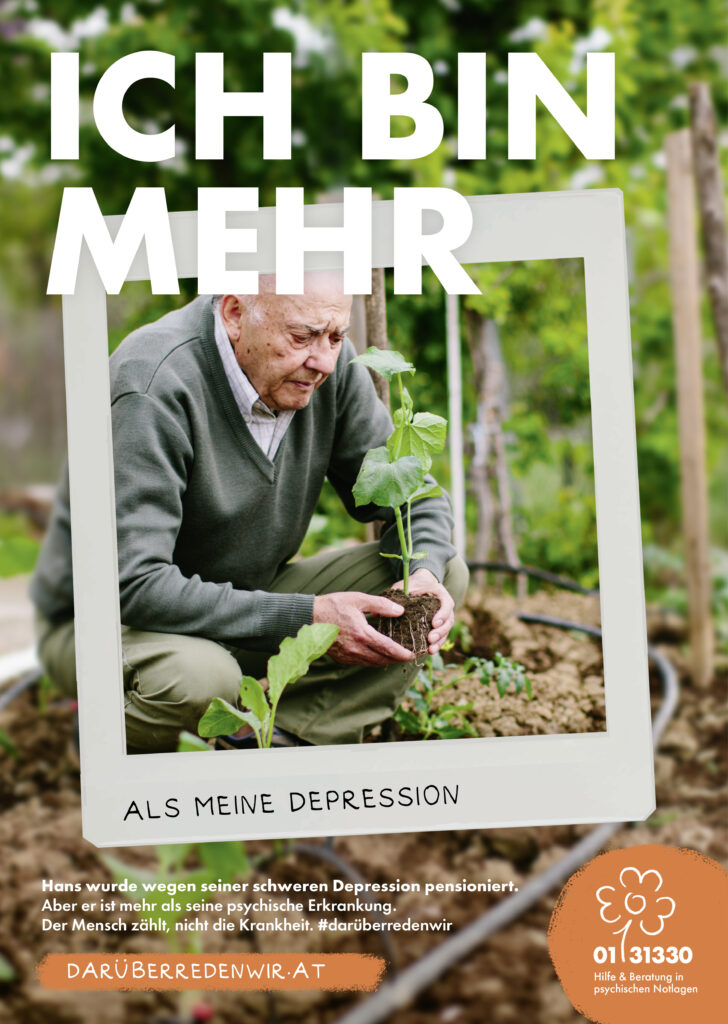Offen über psychische Erkrankungen zu sprechen, erfordert Mut. Auf Twitter hat genau diesen Mut @FrauBadbits vorgemacht. Denn offen über unsere psychische Gesundheit zu reden, das kann auch anderen Kraft und Hoffnung geben. @FrauBadbits leidet unter Posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen und Angststörungen. Nachdem sich die Panikattacken in letzter Zeit deutlich verringert haben und Angstzustände schon monatelang nicht mehr eingetreten sind, hat sie zusammengefasst, was ihr persönlich geholfen hat. Via Twitter hat sie diese Tipps geteilt – um anderen nicht nur Inspiration zu geben, sondern durch ihre persönlichen Erfahrungen auch Hoffnung zu erzeugen:

1. WATCH YOUR BODY Ok ok, das machen Panikler*innen sowieso vielleicht ein bisschen zu viel. Aber macht es trotzdem, nur eben richtig. Lasst euch EINMAL von Ärzt*innen durchchecken. Wirklich. Nur ein einziges Mal. Und zwar nicht auf eine super seltene Krankheit, sondern lasst nachsehen, ob die gängigsten Auslöser für Angst und Depressionen bei euch ok sind. Das sind die Schilddrüse und Nährstoffe. Bei den Nährstoffen am üblichsten: Eisen, Zink, Selen, Jod, B12 und D3 Ist alles bei euch okay, dann ist es die Psyche. Und das ist nicht schön, aber ok.
Wieso das so wichtig ist? – ihr habt die Gewissheit, dass ihr körperlich ok seid und das hilft – wenn es euch körperlich nicht gut geht, seid ihr psychisch auch weniger widerstandfähig. Das ist normal. – wenn‘s eine körperliche Ursache hat, könnt ihr machen was ihr wollt: Es wird nicht besser, wenn die Ursache nicht behoben wird.
2. MOVE THAT ASS „Mach doch einfach Sport“ hat noch nie jemanden geholfen. Wird es auch nicht. Menschen mit Depressionen können nämlich oft gar kein Sport machen. Wenn sie es könnten, ginge es ihnen nicht so schlecht, wie es ihnen geht und das wäre schon gut. ABER:
Bewegung hilft leider tatsächlich. Und dabei muss es nicht mal Sport sein. Aufräumen, spazieren … die alltäglichen Dinge eben helfen oft auch schon. Und wenn‘s ganz doll am Antrieb hapert, hilft es mir immer, einen Timer zu stellen. Ich kann nicht alles schaffen, aber ich kann 5 oder 10 Minuten zumindest etwas schaffen. Und man fühlt sich gleich besser. Und zum Sport … tja.. also wenn ich einem psychisch kranken Menschen eine „Sportart“ empfehlen müsste, wäre es Yoga. Und zwar aus guten Gründen. Yoga hilft erwiesenermaßen am allerbesten. Wieso?
Ganz einfach. Man hampelt nicht sinnlos rum. Man kommt ins spüren. Man meditiert, kommt zur Ruhe und strengt sich doch manchmal ganz schön an. Alles in einem, sozusagen. Und man kann seine Praktik immer seiner Laune anpassen. Insbesondere „Umkehrhaltungen“ helfen ungemein, weil

3. BE SPIDER(WO)MAN Spinn dir ein Sicherheitsnetz. Such dir Leute, die dich verstehen. Online, in Selbsthilfegruppen. Vertrau dich Freunden und Familie an. Psychiater*innen, Therapeut*innen – alles was irgendwie helfen kann. Spinn dir ein Netz. Das ist mit das allerwichtigste!
4. FEED YOUR SOUL Mach mal die Augen zu. Also nur kurz. Atme mal tief ein und aus. Und dann frage dich, was dir gerade guttun würde. Irgendwas realistisches. Und wenn dir nichts einfällt: was hat dir in der Vergangenheit gutgetan? Wo hast du dich wohlgefühlt? Wobei hattest du Spaß? Wo konntest du Kraft tanken? Vielleicht möchtest du im Wald spazieren. Oder mal wieder schwimmen gehen. Vielleicht auch nur eine Tasse Tee trinken. Oder einen extra leckeren Kuchen essen. Was auch immer es ist, was dir guttut: tu es. So oft es geht. So viel es geht.
5. DANCE LIKE NO ONE IS WATCHING Das Leben ist ein Tanz. Kein Sprint. Nicht mal ein Marathon. Es ist ein Tanz. Mal gehts 2 Schritte vor, dann einen zurück. Vielleicht auch mal einen zur Seite. Wie auch immer. Tanze einfach in deinem Rhythmus.
Es ist völlig okay, wenn du ein paar Fortschritte gemacht hast und dann ein Rückschlag kommt. Oder wenn du merkst, dass du mit deiner Strategie nicht weiterkommst und du dann eine andere ausprobierst. Es ist nicht nur okay, sondern es ist richtig richtig gut, denn so lernst du unfassbar viel über dich und das Leben. Such dir den Soundtrack deines Lebens aus und dann Tanz dazu.
6. THE BEST VERSION OF YOU IS YOU Klingt komisch, ist aber so. Es gibt Gründe, sehr gute Gründe, warum es dir momentan nicht gut geht. Das ist nicht schön, aber okay. Du musst da sein, wo du gerade bist und wie du gerade bist, denn das ist genau richtig. Und wenn du das akzeptiert hast, dann mach nochmal die Augen zu, atme noch mal und dann stell dir mal vor, wie du wärst, wenn du absolut psychisch gesund und glücklich wärst. Wie würde sich das anfühlen? Was wäre in deinem Leben anders? Was würdest du anders machen? Mach‘s!
7. BETTER SAVE THAN SORRY Macht euch einen Notfallplan. Wenn ihr wisst, dass ihr in eine für euch schwierige Situation macht, bereitet euch vor. Fragt euch, was das absolute Worst-Case-Szenario ist (das wisst ihr ja eh) und dann überlegt euch Handlungsoptionen.
Beispiel: ich bin mit BFK alleine zuhause. Worst-Case: er verletzt sich und muss ins Krankenhaus. Und ich hab kein Auto. Handlung im Fall: Rettungswagen rufen Alternativer Gedanke: bisher ist das noch nicht passiert. Ich kann gut auf mich und mein Kind aufpassen.

8. KNOW YOUR ENEMY Psychische Erkrankungen haben viele Gesichter. Und zwar alle. Kenne deine ganz genau. Erkenne sie frühzeitig. Lerne alles über deine Erkrankung. Je besser du sie verstehst, desto besser kannst du dich wappnen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man sein Gehirn voll gut verarschen kann? Wenn man 2 Minuten lächelt, fängt das Gehirn an, Glückshormone auszuschütten. Die Muskeln, die man zum Lächeln braucht sagen den Nerven „keine Ahnung warum, aber ich scheine fröhlich zu sein“ und die Nerven sagen „ok alles klar, ich sag’s dem Gehirn“. Das Gehirn checkt die Lage und denkt sich „komisch, fröhlich sehe ich hier nicht, aber die Muskeln müssen es ja wissen. Hier paar Botenstoffe, will ja niemandem im Weg stehen“
9. IT’S ONLY CHEMISTRY Bei psychischen Erkrankungen herrscht immer ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn vor. Das kann man ausgleichen. Mit Sport zum Beispiel. Es sei denn, man ist krank, dann nicht. Weil man dann kein Sport machen kann. Aber dann kann man Medikamente nehmen, die dafür sorgen, dass es euch besser geht im besten Fall. Viele Antidepressiva zum Beispiel funktionieren so, dass sie die Wiederaufnahme von Serotonin hemmen. Das bedeutet, Serotonin (macht glücklich) bleibt länger im synaptischen Spalt. Ich will jetzt nicht so sehr ausschweifen. Nur kurz gesagt: die eine Zelle sagt der anderen länger, dass es euch gut geht. Man kann’s ja mal probieren.
Nachtrag: mein Wissen bezüglich Antidepressiva ist offensichtlich veraltet. Das liegt daran, dass ich mich 1x schlau gemacht hab, bevor ich zum ersten Mal welche nahm. Das war mit 18 – seitdem nicht mehr, weil es für mich plausibel klang und die Medikamente mir heute noch helfen.