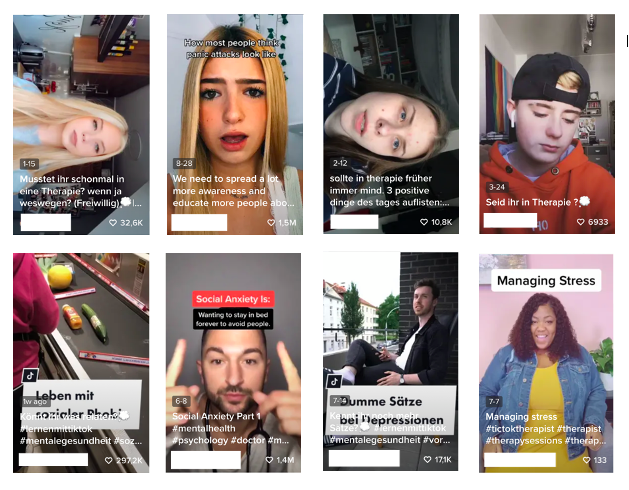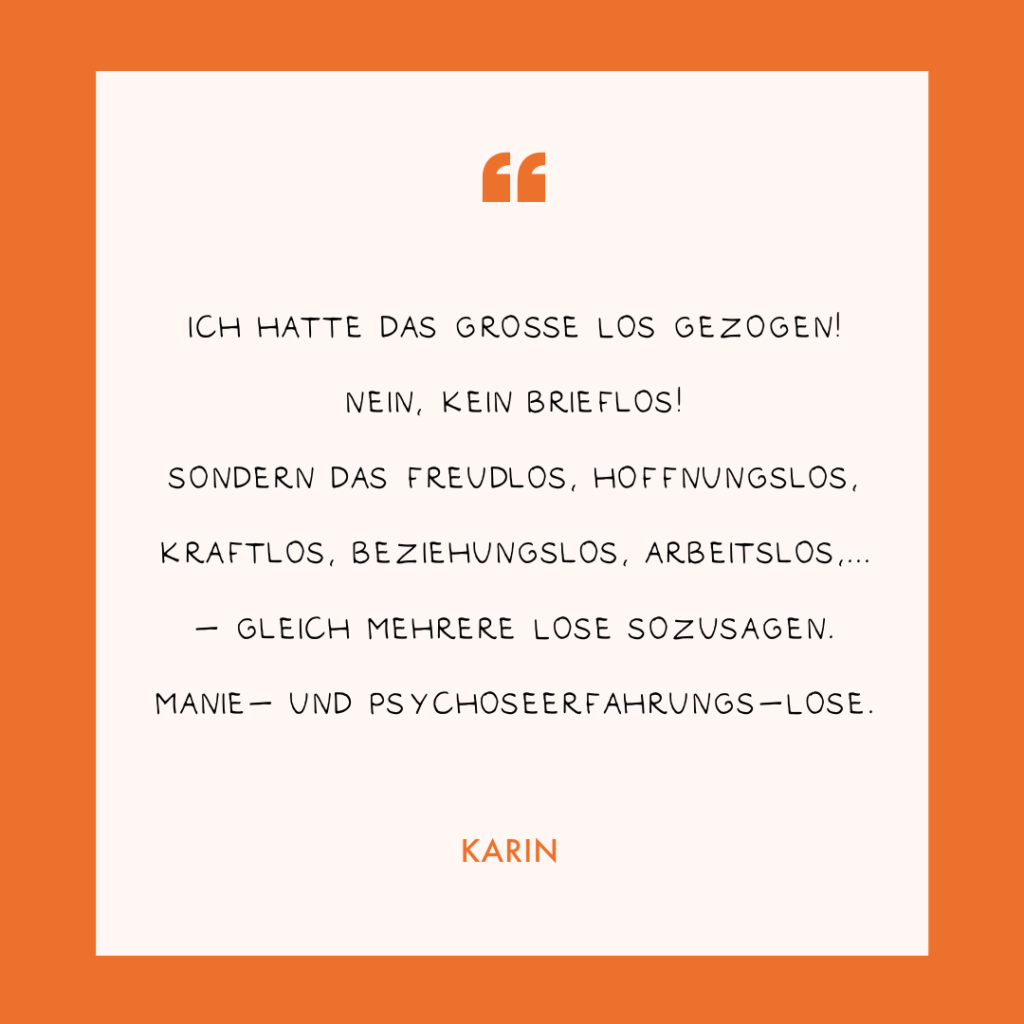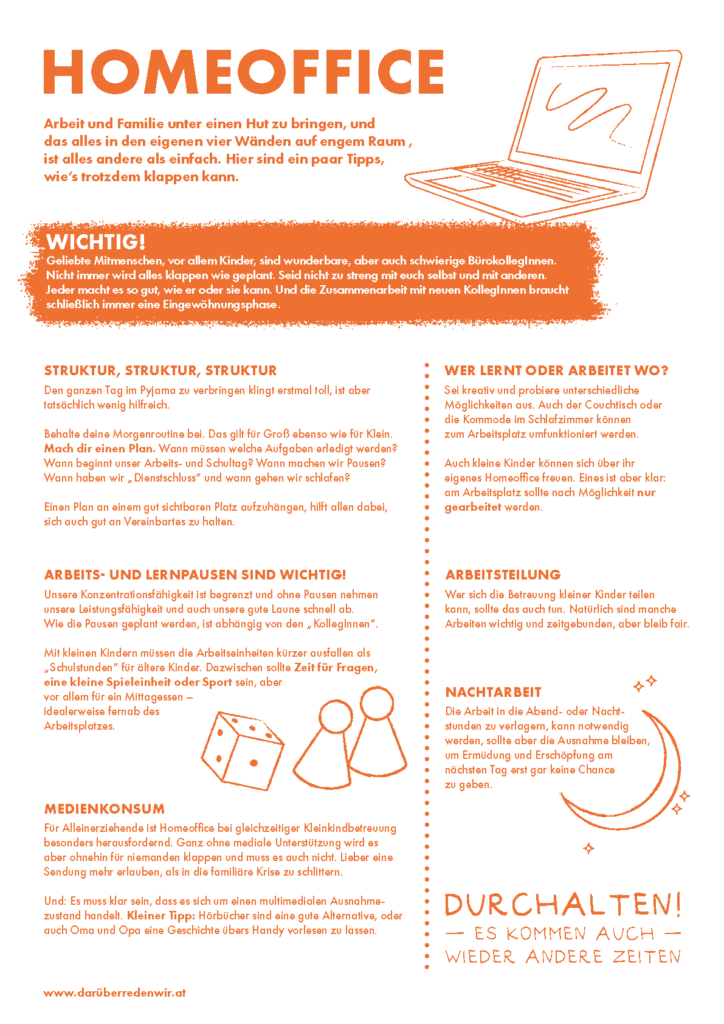15 Prozent aller Frauen sind von der postpartalen Depression betroffen – doch darüber wird kaum gesprochen. Nicht nur das Unwissen und die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, auch das konservative Rollenbild erschweren das offene Gespräch. Wir haben zum internationalen Frauentag Doktorin Claudia Reiner-Lawugger, leitende Oberärztin, zu diesem Thema interviewt. Was macht diese Art der Depression aus, wohin können sich die Frauen selbst, aber auch Angehörige wenden und wie erfolgreich ist die Behandlung.
Was ist eine Postpartale Depression?
Eine postpartale Depression ist eine die psychische
Erkrankungen im ersten Jahr nach einer Entbindung, die meist zwei bis drei
Monate nach der Geburt des Kindes einsetzt. Dabei gibt es Krankheitsbilder wie
bei einer Depression oder Angsterkrankung.
Gibt es Ursachen für diese Art der Depression?
Um die
Geburt herum verändert sich sehr viel. Es ist also an sich eine große
psychische Leistung, die erbracht werden muss, um diese Veränderungen gut zu
verarbeiten. Die Zeit während der Schwangerschaft ist ebenfalls von sehr viel
Stress und Angst geprägt. Man ist nicht einfach nur schwanger und nach neun
Monaten kommt das Kind zur Welt. Es gibt viele Tests und Untersuchungen, die
teilweise zu beständiger Unsicherheit führen.
Manche Mütter setzen sich
selbst enorm unter Druck..
Sogenannte Leistungsmütter haben das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen,
alles wissen zu müssen und alles selbst erledigen zu müssen. Das funktioniert
selten. Der selbst auferlegte Druck und die 200 Baby-Ratgeber machen es für
Frauen nicht einfacher.
Frauen, die
z.B, in ihrer Jungend an psychischen Erkrankungen gelitten haben, sind einem
größeren Risiko ausgesetzt. Aber auch zusätzliche Umstände können zu viel
werden – etwa der Tod einer
nahestehenden Person oder auch schon ein Umzug.
Wie sieht diese postpartale Depression aus?
Eine
postpartle Depression kann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Eine Gruppe
von Müttern zieht sich komplett zurück, verliert den Kontakt zur Außenwelt. Der
Kontakt zum Kind funktioniert allerdings – also sowohl emotional, aber auch
beim Stillen beispielsweise.
Die
andere Gruppe von Müttern tut sich sehr schwer mit dem Kontakt zu dem Baby,
empfindet das Kind als störend. Das ist allerdings keine bewusste Entscheidung. Es sind Emotionen, gegen
die die Frauen nichts tun können. Das ist zur psychischen Erkrankung eine
zusätzliche schwere Belastung für viele, dass sie die Bindung zum Kind nicht
spüren.
Was sind die Symptome?
Die
Symptome sind meistens Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen und
Schlafstörungen. Das ist im ersten Moment für vielen nicht klar zu definieren,
da man in den ersten Monaten nach der Geburt grundsätzlich nicht viel schläft.
Aber wenn es dazu über Wochen hinweg kommt, dass man nicht mehr einschlafen
kann, dass man nicht schlafen kann, obwohl es Kind und PartnerIn tun, dann wird
irgendwann der Punkt der totalen Erschöpfung erreicht. Das erschwert natürlich
die Situation zusätzlich.
Einen Satz
hört man von vielen Betroffenen: „Ich hätte gerne mein altes Leben zurück“.
Diese Mütter fühlen sich abgeschnitten von der Außenwelt, auch bedingt durch
selbstauferlegte Verbote. Sie meinen, sie dürfen keinen Sport mehr machen,
nicht mehr ausgehen, sich nicht mehr mit FreundInnen treffen. Und ziehen sich
dann immer weiter zurück.
Was kann ich tun, wenn ich bei einer Bekannten oder Freundin bemerke, dass etwas nicht stimmen könnte?
Ansprechen.
Das wichtigste ist, darüber zu reden. Gerade in Wien haben wir sehr viele
Möglichkeiten, das dann aufzufangen.
Wenn man
bemerkt, dass sich eine Bekannte immer weiter zurück zieht, dann sollte man
nachfragen. In Richtung: Du meldest dich nicht mehr, was ist denn los? Geht es
dir wirklich gut? Es ist schön, dass es mit dem Baby funktioniert, aber wie
geht es denn dir selbst?
Sollte dann
im Gespräch herauskommen, dass eine psychische Erkrankung nicht
unwahrscheinlich ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Frau kann zu
uns in die Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie im Wilhelminenspital
kommen. Sie kann in einem Eltern-Kind-Zentrum Unterstützung erfragen oder sich
an ihre Hebamme wenden.
Wie sieht die Behandlung von Betroffenen aus?
Es beginnt
mit einem Gespräch. In leichten Fällen können schon kleinere Maßnahmen eine
Erleichterung für die Frauen sein – zum
Beispiel der Besuch einer Eltern-Kind-Gruppe, um die Isolation aufzubrechen und
mit anderen Müttern in Kontakt zu treten.
Bei der
Diagnostik schauen wir, welche Art der Behandlung in jenen Fällen nötig ist,
die schwerwiegender sind. Wir klären also ab, ob es eine medikamentöse
Behandlung oder eine Psychotherapie braucht oder eine Sozialpsychiatrische Behandlung
notwendig ist. Es kann schließlich auch sein, dass mehrere Faktoren die
Erkrankung bewirken oder eine Genesung erschweren. Wir wollen den Müttern die
umfassende Hilfe anbieten, die sie brauchen.
Wie sind die Chancen, eine postpartale Depression wieder loszuwerden?
Sehr gut! Umso
früher eine Behandlung beginnt, desto größer sind die Erfolgschancen.
Kann sie nach der zweiten Geburt wieder auftauchen?
Es ist
selten, aber ich kann das Risiko nicht ausschließen. Grundsätzlich rate ich
hier Frauen, die schon eine postpartale Depression erlitten haben, bei der
nächsten Schwangerschaft sich einfach zu melden. So können wir einen Plan
aufstellen und präventiv Maßnahmen ergreifen und damit das Risiko sehr gering
halten.
Laut internationalen Studien sind bis zu 15 Prozent aller Frauen davon betroffen – warum wird so selten darüber geredet?
Die Haltung
gegenüber Müttern ist noch eine sehr konservative. Die Familie muss es sich
selbst richten, die Frau muss es sich selbst richten. Früher in
Mehr-Generationen-Haushalten war es einfacher, dass jemand einspringt. Das ist
heute nicht mehr so. Familien wohnen alleine und oft bleiben die Frauen mit den
Kindern den ganzen Tag alleine zu Hause. Es ist in unserer Gesellschaft
schwierig, Bewusstsein dafür schaffen, dass Mütter eben nicht einfach nur
funktionieren.
Die postpartale Depression ist an sich nicht eindeutig in
den Klassifizierungssystemen ICD-10 oder DSM IV/V abgebildet. Aber bei der postpartalen Depression sind die
veränderten Lebensumstände ein entscheidender Faktor bzw. ein wichtiges
Merkmal. Ohne Abbildung in den Klassifikationssystemen sprechen wir über eine
Erkrankung, die es nicht zu geben scheint.
Seit den 90ern arbeiten wir intensiv daran, dass die
postpartale Depression ebenfalls klassifiziert wird. Dass es nach wie vor keine
Eindeutigkeit gibt, zeigt meiner Meinung nach auch ein gewisses mangelndes
Bewusstsein für diese spezielle Erkrankung, an der besonders Mütter leiden.
Aber es wird besser. Immer mehr Personen des öffentlichen Lebens äußern sich zu dem Thema. In Wien haben wir ein starkes Netzwerk. Wir sensibilisieren seit Jahren und mittlerweile wissen viele GynäkologInnen und Hebammen Bescheid und wenden sich an uns.
Doktorin Claudia Reiner-Lawugger ist leitende Oberärztin der Spezialambulanz für peripartale Psychiatrie im Wilhelminenspital.